Beitrag erschienen in Argumente 1/2014: Europa, S. 72-79 (PDF)
Leonhard Dobusch und Nikolaus Kowall
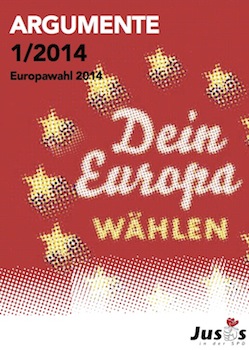 Genau 100 Jahre nach dem Beginn des „Großen Krieges“ ist nicht nur ein Gedenkjahr, es ist auch ein Jahr der Analogien. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Parallelen zwischen 1914 und 2014. Wie Stefan Zweig in „Die Welt von Gestern“ so eindrücklich beschrieben hat, blickten Europas Intellektuelle 1914 auf eine lange, vergleichsweise friedliche Phase zurück und waren von der Welle kriegerischen Nationalismus zumindest überrascht, so sie nicht von ihr erfasst und mitgerissen wurden. War zuvor von europäischer Einigung die Rede gewesen, lag der Kontinent wenige Jahre später in Trümmern und die nationalistische Saat ging auf.
Genau 100 Jahre nach dem Beginn des „Großen Krieges“ ist nicht nur ein Gedenkjahr, es ist auch ein Jahr der Analogien. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Parallelen zwischen 1914 und 2014. Wie Stefan Zweig in „Die Welt von Gestern“ so eindrücklich beschrieben hat, blickten Europas Intellektuelle 1914 auf eine lange, vergleichsweise friedliche Phase zurück und waren von der Welle kriegerischen Nationalismus zumindest überrascht, so sie nicht von ihr erfasst und mitgerissen wurden. War zuvor von europäischer Einigung die Rede gewesen, lag der Kontinent wenige Jahre später in Trümmern und die nationalistische Saat ging auf.
2014 erwartet auch trotz Krim-Krise niemand eine militärische Eskalation. Dennoch mag ein Blick zurück im Sinne einer Reflexionsanalogie dabei helfen, Ideologien und Dynamiken zu identifizieren, die ein respektvolles und menschwürdiges Zusammenleben der Völker gefährden. Bei der herrschenden Konjunktur an Analogieschlüssen gibt es erstaunlicherweise ein Themenfeld, das kaum Erwähnung findet, trotz dessen entscheidender Bedeutung für die Ereignisse 1914. Denn völlig unabhängig von der derzeit wieder einmal diskutierten Frage, ob die europäischen Staaten als „Schlafwandler“ (Christopher Clark [1]) in den Krieg „geschlittert“ (Lloyd George) waren oder vor allem der deutsche Griff nach der Weltmacht als ursächlich zu sehen ist (Fritz Fischer [2]), maßgeblich für die Katastrophe war jedenfalls eine dominante imperialistische Ideologie. Unsere These ist, dass wir es 2014 mit einem vergleichbaren, allerdings weniger militärisch und dafür stärker wirtschaftlich ausgeprägten Imperialismus zu tun haben.
Inhalt
Imperialismus als Wettbewerbsideologie
Kern imperialistischer Ideologie vor 1914 war die Überzeugung, dass für Wohlstand und Erfolg einer Großmacht Expansion in Form von Kolonien und die damit verbundene Erschließung ausländischer Bezugs- und Absatzmärkte erforderlich sind. Die imperialistische Ideologie war aber nie nur eine wirtschaftliche. Für die Eliten der wilhelminischen Ära waren Kolonien und Weltmachtstreben immer auch eine Frage „des Prestiges, der Ehre, der weltpolitischen Gleichberechtigung“[3]. Eine Einstellung, die in der Forderung des späteren deutschen Reichskanzler Bernhard von Bülow nach einem „Platz an der Sonne“ für Deutschland besonders deutlich wurde. In seiner Reichstagsrede im Jahr 1897 erklärte es von Bülow zu „eine[r] unserer vornehmsten Aufgaben, gerade in Ostasien die Interessen unserer Schiffahrt, unseres Handels und unserer Industrie zu fördern und zu pflegen.“ Als roter Faden durch die ganze Rede zieht sich die Überzeugung, dass Deutschland im Wettbewerb mit den anderen „Großmächten“ steht. So sollte „der deutsche Unternehmer, die deutschen Waren, die deutsche Flagge […] geradeso geachtet werden wie diejenigen anderer Mächte.“ Der Blick über die Grenzen des deutschen Reiches hinaus erlaubte außerdem, von wachsenden sozialen Spannungen im Inneren abzusehen, wenn nicht sogar abzulenken. So stellte der britische Imperialist Cecil Rhodes 1895 fest, dass, wer den Bürgerkrieg vermeiden wolle, zum Imperialisten werden müsse. Der britische Historiker Hobsbawm ergänzt dazu, dass man „für manche Länder – insbesondere Deutschland – […] das Aufkommen des Imperialismus sogar in erster Linie mit dem ‚Primat der Innenpolitik‘ erklärt [hat]“.
 Imperialistischer Wettbewerb anno 1913 in ökonomischen Kennzahlen
Imperialistischer Wettbewerb anno 1913 in ökonomischen Kennzahlen
Ein Blick auf die herrschende (Wirtschafts-)Ideologie des Jahres 2014 offenbart erstaunliche Parallelen. Der zentrale Orientierungspunkt deutscher Politik ist jener der „Wettbewerbsfähigkeit“, wie sich schön an Hand von Angela Merkels Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2013 illustrieren lässt. Merkel forderte dort „eine Wettbewerbsfähigkeit, die sich daran bemisst, ob sie uns Zugang zu globalen Märkten ermöglicht.“ Der Blick richtet sich wie damals vor allem nach Außen, zweimal warnt Merkel in ihrer Rede davor, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht „irgendwo im Mittelmaß“ oder „beim Durchschnitt aller europäischen Länder“ liegen dürfe. Indikator für Wettbewerbsfähigkeit seien „Überschüsse in den Leistungsbilanzen“, die „wir auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen“ dürften. Nur so könne man „ein wichtiger Spieler am Weltmarkt“ mit Unternehmen sein, „die als schlagkräftige Akteure auch weltweit agieren könne.“ Wieder geht es um den Platz an der Sonne, wenn er auch nicht mit militärischen Mitteln sondern durch die in der Rede an erster Stelle erwähnten Lohnzusatzkosten und Lohnstückkosten erkämpft werden soll.
Sozialdemokratie und Imperialismus
Interessant ist in beiden Fällen das Verhalten der Sozialdemokratie. Auch vor 1914 stand die SPD den imperialistischen Abenteuern skeptisch gegenüber und beklagte die hohen Kosten der Kolonien. Der internationalistische Anspruch der Partei spielte eine größere Rolle als heute, die Ausrichtung der Sozialdemokratie war klassenkämpferischer. Noch am 25. Juli 1914 warnte der SPD-Parteivorstand im Vorwärts, dass „die herrschenden Klassen, die euch in Frieden knechten, verachten, ausnutzen, euch als Kanonenfutter mißbrauchen [wollen]“, und ließ „die internationale Völkerverbrüderung“ hochleben. Etwas mehr als eine Woche später begründete der Parteivorsitzende Hugo Haase jedoch die Zustimmung der SPD-Fraktion zu den Kriegskrediten im Reichstag damit, „das eigene Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht im Stich zu lassen.“ Der Wunsch nicht als vaterlandslose Gesellen dazustehen dominierte, die prinzipielle Ablehnung des Imperialismus wurde im konkreten Fall den vermeintlich nationalen Interessen untergeordnet. Eine Spaltung der Sozialdemokratie in MSPD und USPD war die Folge.
Knapp 100 Jahre später lässt sich ein ähnliches Muster im Umgang der SPD mit der herrschenden Wettbewerbsideologie beobachten. Zwar werden Unternehmen dafür kritisiert, Staaten gegeneinander auszuspielen („Heuschrecken“), und die negativen Auswirkungen des Standortwettbewerbs in Form von Lohn- und Steuersenkungswettläufen durchaus als solche erkannt. Im konkreten Krisenfall aber verfolgte die deutsche Sozialdemokratie wieder eine nationalistische Steuersenkungs- und Lohnzurückhaltungspolitik. Das neoimperialistische Denkmuster, das der deutschen Agenda 2010 zu Grunde lag und zu einer neuerlichen Spaltung der Sozialdemokratie in Deutschland geführt hat, wird in Gerhard Schröders Plädoyer für eine Agenda 2020 deutlich: „Deutschland kann seinen Vorsprung gegenüber aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie Brasilien und China nur verteidigen, wenn wir hart an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.“
Imperialismus als ökonomisches Null-Summen-Spiel
Eric Hobsbawm ist der Auffassung, dass der überzeugendste allgemeine Beweggrund für die koloniale Expansion die Suche nach neuen Märkten war. Dabei war schon vor 1914 umstritten, ob sich Imperialismus in Form von Kolonien überhaupt rechnet. Hobsbawm ist beispielsweise der Meinung, es gebe „keine stichhaltigen Anhaltspunkte, dass koloniale Eroberung als solche einen besonderen Einfluss auf die Beschäftigungsquote oder die Realeinkommen der meisten Arbeiter in den Mutterländern gehabt hätten (…) Weit bedeutsamer war die gängige Praxis, den Wählern Ruhm statt Reformen, die weit kostspieliger gewesen wären, anzubieten.“[4] Karl Kautsky, Chefideologie der SPD um 1900 belegte mit statistischen Aufschlüsselungen über die Ausweitung der Eisenbahnkilometer, dass die Ausdehnung des Weltmarkts und der Produktion nicht in den Kolonien, sondern im Zentrum stattgefunden hat. Die Kosten für die Überseekriege würden hingegen die Erträge bei weitem übertreffen.[5] Ähnlich argumentierte Eduard Bernstein die britischen Kolonien betreffend: „Nun kann man es gewiß als sehr zweifelhaft bezeichnen, ob das englische Volk in seiner Masse von der Herrschaft Englands über Indien wirtschaftlichen Vorteil hat. Nach meiner Ansicht ist das Gegenteil der Fall.“[6]
Die wirtschaftliche Rechtfertigung des Imperialismus beruhte auf der heute noch unter vielen Ökonomen gängigen Fehlannahme, die Triebfeder ökonomischer Entwicklung beruhe auf der globalen Expansion des Handels. Der deutsche Imperialismus war getrieben von der Vorstellung, im Wettbewerb um die Aufteilung einer knappen Erde im Hintertreffen zu liegen und dadurch langfristig ökonomisch zu unterliegen.[7] In der Spätphase des Imperialismus erschien 1912 J.A. Schumpeters „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, die die kapitalistische Dynamik in erster Linie in Innovationen und Produktivitätsfortschritten erkennt. Diese endogene Entwicklungstheorie erklärt ökonomischen Fortschritt primär mit kapitalistischen Dynamiken der „schöpferischen Zerstörung“ und unterscheidet sich von merkantilistischen oder imperialistischen Entwicklungstheorien, die die Rolle des Außenhandels in den Vordergrund stellen. Der Aufholprozess des deutschen Reichs und der USA gegenüber der Kolonialmacht England zur vorletzten Jahrhundertwende ist ein Indiz dafür, dass globale Präsenz wohl eher die Folge als die Ursache wirtschaftlicher Dynamik ist. Diese Unterscheidung ist von großer Bedeutung: Ist die wirtschaftliche Entwicklung endogen, also von inneren Ursachen getrieben, dann kann der Kuchen für alle wachsen. Ist Entwicklung hingegen im Rahmen eines handelsbasierten Nullsummenspiels zu verstehen, dann kann A nur gewinnen, was B verliert. Die Entwicklung des einen ist hier immer die Regression des anderen.
Die imperialistische Logik des Standortwettbewerbs
Die Rechtfertigung für das Primat der Wettbewerbsfähigkeit in der deutschen Wirtschaftspolitik folgt der expansiven Logik des Imperialismus. Wenn Deutschlands Löhne stärker steigen und deshalb die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, bekommt es ein kleineres Stück des Kuchens und es gibt weniger zu verteilen. Die Weltwirtschaft wird als Nullsummenspiel gesehen, in dem Europa nur überleben kann, wenn die europäischen ArbeitnehmerInnen im globalisierten Wirtschaftskrieg gegen China und Brasilien auf Lohnerhöhungen verzichten. Obwohl das jährliche globale BIP-Wachstum augenscheinlich zeigt, dass der Kuchen für alle wachsen kann und es vor allem darum gehen muss, dieses Wachstum ökologisch nachhaltig zu gestalten, ist die Diskussion in Deutschland und Europa geprägt von Verlust- und Untergangsängsten. Zur wichtigsten rhetorischen Figur des zeitgenössischen Neoimperialismus wurde der Standardortwettbewerb – ein Kampf um Direktinvestitionen und Marktanteile am Welthandelsvolumen. Rainer Land und Ulrich Busch betonen, dass beim Standortwettbewerb Motive der Umverteilung im Vordergrund stehen: „Hier versuchen die Marktteilnehmer durch Wettbewerbsvorteile (Lohnniveau, Steuerniveau, Regelungsdichte, Umwelt- und Sozialstandards usw.) anderen Marktanteile wegzunehmen, also Effekte durch Umverteilung statt durch Produktivitätssteigerungen zu erreichen.“[8]
Der Verweis darauf, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, dass Kooperation Europa und die Weltwirtschaft voranbringen würde ohne Deutschland zu schaden, kommt führenden SPD-PolitikerInnen nicht über die Lippen. Von einer Öffentlichkeit die angeblich nicht weiter zu blicken bereit ist als um die nächste Ecke, würde ein solcher Vorstoß als wirtschaftsschädlich und unpatriotisch aufgefasst werden. Sigmar Gabriels Besuch bei Frankreichs Wahlsieger Francois Hollande wurde etwa von Cicero-Redakteur Wolfram Weimer in der ARD so kommentiert: „Wieso fällt der in dem Moment wo die Kanzlerin einigermaßen tapfer für deutsche Interessen kämpft ihr in den Rücken bei dem ärgsten Widersacher?“ Wenn die SPD internationale Kooperation auch nur andenkt wird sie mit dem Stigma der vaterlandslosen Gesellen gebrandmarkt, ohne dem kraftvoll argumentativ entgegenzutreten.
Ohne deutschen Sinneswandel zerbricht die Eurozone
Die Wirtschaftskrise 2008, die vor allem in Europa auch eine drastische Krise des Neoimperialismus darstellte, wurde kaum als solche interpretiert. Um die abstrakte Materie zu popularisieren fehlte in der linken Mitte das politische Verständnis. Stattdessen setzten sich Interpretationen durch, die konkrete Feindbilder anbieten konnten. Bildlich und plastisch ist das Bild des faulen Griechen mit Sonnenbrille in der Hängematte, der auf unsere Kosten ein gemütliches Leben führt. Klischees ergossen sich über die südeuropäischen Länder. Niemand interessierte sich dafür, dass Spaniens Exporte vor der Krise stärker wuchsen als die deutschen, niemand beachtete, dass der Anteil der Löhne am italienischen Volkseinkommen vor der Krise rückläufig war. „Die Party im Süden ist zu Ende“, so der Vorurteile schürende Befund des Mainstream-Ökonomen Hans-Werner Sinn an die Adresse der Krisenstaaten.
Noch krasser als Südeuropa wurde aber ein anderes Land in Deutschland Opfer einer sagenhaften Propagandakampagne. Seit Jahren ist die deutsche Berichterstattung über Frankreich geprägt von nationaler Überheblichkeit und Geringschätzung. 2011 warnte Der Spiegel: „Nun gerät auch die europäische Wirtschaftsgroßmacht Frankreich ins Wanken. Jahrzehntelang hat das Land geprasst und seinen Konsum auf Pump finanziert.“ Und weiter: „Neidisch blicken die Franzosen neuerdings auf das „modèle allemand“, das deutsche Modell. Die Zeitungen sind voll von Tabellen und Grafiken, in denen Deutschland immer vorn liegt.“ 2014 titelt Die Zeit schließlich wenig originell mit „Der kranke Mann Europas“, fordert „Frankreich braucht Reformen“ und bedauert, dass „eine Reformagenda á la Schröder“ immer noch als nicht auf Frankreich übertragbar angesehen wird. Auf die deutschen Sozialdemokratie ist aber in wirtschaftlich-nationalen Fragen Verlass und der diesbezügliche Burgfriede bislang nicht in Gefahr: „Im Kern unterscheidet die Position der SPD sich aber nur wenig von der der Kanzlerin. […] Euro-Bonds, wie Hollande sie sich vorstellt, haben in der SPD-Spitze wenig Fürsprecher. Zudem hält die SPD Reformen in Frankreich genau wie die Kanzlerin für unumgänglich. “Die Franzosen sind in einem Zustand, wie wir es 2001 waren”, sagt Steinmeier.“(Der Spiegel) Wenn Deutschland noch vor zehn Jahren als kranker Mann Europas galt, wie hat sich Frankreich innerhalb kurzer Zeit in diese unterlegene Position manövriert?
Vor der Euroeinführung war es die deutsche Bundesbank, die durch ihre Geldpolitik den makroökonomischen Herzschlag in Europa vorgab. Die Währungsunion war weniger ökonomisch motiviert, als eher ein politischer Wunsch der französischen Regierung, diese Währungsvorherrschaft Deutschlands über Frankreich zu beenden. Aus heutiger Sicht ein Schuss ins Knie, denn das Konstrukt „gemeinsame Währung – nationale Wirtschaftspolitik“ hatte fatale Folgen. Es war Deutschland das Ende der 90er-Jahre einen Lohnwettbewerb startete, wodurch die heimische Nachfrage nach Exporten der Partnerländer sank und die deutschen Ausfuhren günstiger wurden. Hätten Frankreich und die anderen damals gleich gehandelt wie Deutschland, wäre Deutschlands Vorsprung niemals zur Geltung gekommen. In Anbetracht dieser Tatsache ist es besonders perfide der Grand Nation die Verantwortung für Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit umzuhängen. Überhaupt ermöglichte erst die Euroeinführung den Erfolg der deutschen Strategie, zu Zeiten der DM-Mark hätten Aufwertungen die deutsche Kaufkraft im Ausland gestärkt und preisliche Vorsprünge wieder zunichte gemacht. Damit es genau zu keiner dramatischen Auseinanderentwicklung der Preisniveaus kommt, ist eine synchrone Entwicklung von Lohnstückkosten und Preisen das eigentliche Geheimnis einer Währungsunion. Im Gegensatz zu den weniger wichtigen Staatsschulden gibt es aber für eine gemeinsame Inflationsentwicklung keine europäische Steuerung.
Wie überall, wo es keine Regeln gibt, herrscht das Faustrecht. Die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik wird von jenen vorgegeben, die ökonomisch am wenigsten Rücksicht nehmen. In der Bundesrepublik wurde der Standortwettbewerb so lange beschworen, bis sie ihn selbst lostrat. Deutschland hat mit seiner aggressiven Handelsstrategie in Europa eine Hegemonialstellung erreicht wie seit 1945 nicht mehr. Während deutsche Regierungen unter Helmut Schmidt oder Helmut Kohl ihre wirtschaftliche Vorherrschaft im Geiste des Nachkriegskonsens noch politisch abgemildert haben, fehlt der deutschen Öffentlichkeit mittlerweile jegliche Sensibilität für herrisches Gehabe. Diese Rohheit ist ein direktes Resultat von zwei Jahrzehnten unter dem permanenten Eindruck der martialischen Rhetorik des Standortwettbewerbs. Aus ihm speist sich der neu erwachenden Wirtschaftsnationalismus in Deutschland. Das zeitgenössische Gesicht des Nationalismus heißt Standortwettbewerb. Durch das Fehlen einer europäischen Autorität, in der europäische Interessen vermeintlichen nationalen Interessen übergeordnet sind, hat die Kombination aus Standortwettbewerb und Währungsgefängnis den großmannssüchtigen Deutschen wieder seine Schatten über den Kontinent werfen lassen. Es läge vor allem an einer wieder zur Besinnung kommenden deutschen Sozialdemokratie, die zunehmenden Herrschaftsdiskurse in ihrem Heimatland empört zurückzuweisen. Dazu müssen sie aber jene ökonomischen Auffassungen hinter sich lassen, die Deutschland als natürlichen Gewinner eines fairen Wettbewerbs erscheinen lassen. Der Schritt von einer einzelwirtschaftlichen hin zu einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise wird zu entscheidenden Herausforderung für einen Wandel von Deutschland als Führungsmacht hin zu Deutschland als Partner.
Wie 1914 bewegen wir uns auf eine politische Eruption in Europa zu und wie 1914 ist das deutsche Streben nach Dominanz eine wesentliche Ursache der Polarisierung. Noch erkennen die Regierungschefs von Frankreich, Italien und Spanien nicht, dass sie sich für ihr wirtschaftliches Überleben entweder des Euros oder der marktradikalen deutschen Vorherrschaft auf europäischer Ebene entledigen müssen (was wiederum auf einen Austritt Deutschland aus dem Währungsverband hinauslaufen würde). Wenn diese Erkenntnis jedoch reift, werden die politischen Folgen fatal sein. Wohl wird es keinen Krieg in Europa geben, aber die Währungsunion wird zerbersten und die europäische Integration wird um eine Generation zurückgeworfen werden. Es gibt natürlich einen anderen Weg – auf diesen haben aber die Südeuropäischen Länder keinen Einfluss. Es könnte sein, dass sich in Deutschland die Erkenntnis durchsetzt, dass man mit den anderen europäischen Ländern in einem Boot sitzt und der kurzfristige Vorteil Deutschlands ein langfristiger Nachteil Europas ist, während ein kurzfristiger Vorteil Europas auch zu einem langfristigen Vorteil Deutschlands werden könnte. Die jüngste Anerkennung der dramatischen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse als eventuelles Problem durch das Bundeswirtschaftsministerium ist in dieser Hinsicht ein erster kleiner Lichtblick. Der Konsens der Eliten, das deutsche Heil im internationalen Wettbewerb zu suchen, scheint jedoch 2014 nicht viel schwächer zu sein als 1914.
Endnoten:
[1] Clark, C. (2012): The Sleepwalkers. How Europe went to War in 1914. London: Allen Lane.
[2] Fischer, F. (1961): Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf: Droste.
[3] Winkler, H.A. (2008): Die Deutschen, Teil 10: Wilhelm und die Welt.
[4] Hobsbawm, E. (2008): Das imperiale Zeitalter, S. 94.
[5] Kautsky, K. (1909): Der Weg zur Macht: Politische Betrachtungen über das Hineinwachsen in die Revolution, S. 76-77
[6] Bernstein (1907), keine Seitenangabe
[7] Busch, U./Land, R. (2010): Teilhabekapitalismus: Fordistische Wirtschaftsentwicklung und Umbruch in Deutschland 1950 bis 2009, S. 19


super!
danke
Der Kapitalismus und Neoliberalismus funktioniert nur dann, wenn durch Arbeit Wohlstand erleistet werden kann und wenn Kapital investiert wird um nutzbringende Leistungen für die Gesellschaft bereitzustellen. Die Zinsen sind so niedrig, weil viele Kapital zurückhalten und wenig Kapital investieren und die €-Zone im Tief steckt. Wir haben bei den privaten Reichen keine Neoliberalen, die Wohlstand und Fortschritt für die Gesellschaft schaffen wollen durch Innovation, in Europa sind die privaten Reichen in einem feudalen antiquierten Denken verhaftet. Die EZB handelt vollkommen marktkonform, Draghi sollte einen negativen Leitzins setzen, da das der Marktsituation entspricht: Es halten viele Kapital zurück und daher wird dieses Markt Ungleichgewicht mit niedrigst Zinsen zum Ausdruck gebracht. Hohe Zinsen sind bei einer Geldschwemme nötig, damit keine Hyperinflation ausgelöst wird, weil da hält fast niemand dann Geld zurück und es investieren alle wie rasend.
https://news.yahoo.com/minimum-wage-approaches-likely-senate-rejection-163455439–finance.html
In den USA wird gestritten, ob 7US$ oder 10US$ Mindestlohn pro Stunde
ro Stunde.
Deutschland ist Kambodscha mit 1€ Jobs Aufstocker!
Nein so schlimm ist es nicht, aber trotzdem wird in Kambodscha derzeit gestritten, ob 120 US$ oder 160 US$ pro Monat Mindestlohn für Analphabeten als Fabriksarbeiter
Nur Bangladesch ist noch günstiger für Billigarbeit als Kambodscha. Das heißt, im zweitgünstigsten Sublieferantenland der Billigsttextilindustrie gelten mehr Standards bzgl. Mindestlohn als in Deutschland, weils dort schon Streiterei über die Höhe des Mindestlohns gibt. Vor 10 Jahren waren noch die roten Khmer dort, da sieht man die gewaltige Wohlstandsentwicklung durch den Kapitalismus. In Europa liegt aber was grob im Argen, denn der Mindestlohn in Rumänien liegt mit 179,36€ / Monat nicht mehr so viel über dem von Kambodscha! Allerdings bekommt man mehr in Kambodscha mit dem dortigen Mindestlohn (Kaufkraft) als in Rumänien
Jetzt sind aber viele in Kambodscha Analphabeten und in Rumänien nicht!
Selbst sehr neoliberalen Kreisen der USA, sieht Frau/man inzwischen die staatlich subventionierte Billiglohnpolitik Deutschlands als unfairen Wettbewerb!
aus rein kapitalistischer neoliberaler Perspektive verhindern die Spannungen in der €-Zone auch Investitionen und Innovationen. Zusätzlich gibt es diese riesigen Geldvermögen in Deutschland, die so viel Macht haben, dass sie eine Deflation in der €-Zone erzwingen wollen. Ich bin neoliberale, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass brach liegendes Vermögen durch Inflation langsam an Wert verlieren muss, solange die Bevölkerungszahl im Markt (in dem Fall der €-Länder stagniert oder wächst) Denn nur so wird der Reiche gezwungen sein Vermögen nutzbringend für die Gesellschaft zu investieren.
Wo wir beim nächsten Problem sind: Österreich und Deutschland haben die KEST als flat-tax. Bei der KÖST ist die flat-tax OK, weil auch der Haftungsbestand einer GmbH durch zu progressive KÖST gemindert werden könnte, aber die Kapitalerträge gehören wie andere Einkommen auch progressiv besteuert. Das würde mehr als die Finanztransaktionssteuer meiner Meinung nach wieder mehr zu realen Investionen führen, wo Kapital länger gebunden wird und Unternehmen nicht diesen sehr kurzfristigen Kapitaldruck haben.
Das würde gleichzeitig bewirken, dass realwirtschaftliche Industrielle, die sich mit swaps und hedges gegen die von den Zockern verursachten Schwankungen absichern, keine zu hohe Mehrbelastung durch Steuern hätten (Absicherung ist immer ein leichter Verlust grosso modo), aber die Spekulanten stärker zur Kasse gebeten würden.